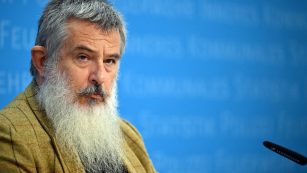Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs unterhielten sich Friedrich Torberg und Egon Erwin Kisch über ihre Aussichten, den aus Deutschland drohenden Gefahren zu entrinnen. Kisch versuchte es gelassen zu nehmen. »Weißt du«, sagte er dem Freund, »mir kann eigentlich nichts passieren. Ich bin ein Deutscher. Ich bin ein Tscheche. Ich bin ein Jud. Ich bin aus gutem Hause. Ich bin Kommunist … Etwas davon hilft immer.«
verhökert Für die Generation von Kisch und Torberg stellte sich mitunter die Frage, welches Getränk man im Café Herrenhof bestellen sollte. Die Frage der Identität stellte sich nicht. Die jüdischen Intellektuellen dieser Zeit waren die letzten unerschütterlichen Mitteleuropäer. Womit wir bei Franz Kafka wären, Prager, Tscheche, K.u.K.-Untertan, Jude und deutschsprachiger Schriftsteller. Aktuell erheben zwei Institutionen Anspruch auf seinen Nachlass: Die israelische Nationalbibliothek in Jerusalem und das Deutsche Literaturarchiv in Marbach. Welchen Aufbewahrungsort Kafka selbst für seinen Nachlass vorgezogen hätte, weiß man: keinen. Schließlich hatte er seinen Freund Max Brod auf dem Sterbebett gebeten, all seine Manuskripte, Tagebücher und Briefe zu vernichten. Brod hat den Freund im Interesse der literarischen Nachwelt verraten. Die Strafe folgte in Gestalt seiner Sekretärin Ilse Esther Hoffe, unter deren Fuchtel Brod in Tel Aviv die letzten Jahre seines Lebens in kafkaesker Furcht verbringen musste. Brod hatte in seinem Testament verfügt, dass Kafkas Nachlass an einem passenden Ort der Öffentlichkeit zugänglich sein sollte, in Israel oder im Ausland. Doch so, wie er Kafkas letzten Wunsch nicht respektiert hatte, so verriet Hoffe Brod. Sie ließ einzelne Texte auf Auktionen an die Meistbietenden verhökern. Auf diese Weise erstand das Marbacher Archiv 1988 das Originalmanuskript von Kafkas Roman Der Prozess. Nach israelischem Recht war der Verkauf allerdings illegal. Deshalb will die Nationalbibliothek in Jerusalem es jetzt zurück.
Eigentlich wäre der richtige Moment, die literarischen Schätze aus Brods Tel Aviver Wohnung zu bergen und in ein israelisches Archiv zu bringen 1968 gewesen, als der Nachlassverwalter Kafkas starb. Doch das Interesse der staatlichen Stellen war damals gleich null. Das hatte ideologische Gründe. In klassisch-zionistischer Terminologie war Franz Kafka nicht das richtige »Menschenmaterial«. Er verkörperte all das, was die Zionisten verachteten: Ein nervöser Schriftsteller mit zwei linken Händen, ein bürgerlicher Kaffeehausbewohner, ein begeisterter Besucher von Bordellen und – noch ärger! – von jiddischen Theateraufführungen. Und – als reiche dies nicht – hatte dieser Galutjude seine verquält-depressiven Texte (in denen man den Zionismus nun wirklich mit der Lupe suchen muss) auch noch in deutscher Sprache verfasst.
luftmenschen Ein Jahr vor Max Brods Tod hatte Israel im Sechstagekrieg den spektakulärsten Sieg seiner Geschichte errungen, unter einer politischen Führung, deren Mehrheit in der Diaspora geboren, und mit Generälen, die im Land groß ge-worden waren. »Wenn Jitzhak Rabin sich aufmachte, um mit der Regierung zu sprechen«, so der Historiker Tom Segev, »sagte er zu den Generälen: ›Ich gehe zu den Juden‹. Und Ministerpräsident Levi Eshkol sagte dann auf Jiddisch: ›Die Preissn kommen‹.« Dass Rabin und seine Altersgenossen zwischen den verachteten »Juden« aus der Diaspora und den im Land groß gewordenen »Hebräern« unterschieden, hatte sich Eshkols Generation selbst eingebrockt. Die zionistischen Gründer hatten dem Bild des heimatlosen »Luftmenschen« der Diaspora das Ideal des wehrhaften, verwurzelten »Neuen Hebräers« entgegengesetzt, der mit dem Pflug ebenso gut umgehen konnte wie mit der Waffe. Die »Dor Ba-Aretz«, die erste Generation der im Lande aufgewachsenen Israelis, hatte diese Ideologie verinnerlicht. Mit dem Bildungskanon ihrer europäisch geprägten Eltern konnte sie entsprechend wenig anfangen. So forderte die kleine, aber einflussreiche »Jung Eretz Israel«-Gruppe um Uri Avnery nach 1945 ein »Goy Chadash«, ein »neues Volk«, mit einer neuen »hebräischen Kultur«. Für einen wie Kafka war in der kein Platz.
Eine Abkehr von dieser Mentalität begann erst zögernd 1961, beim Eichmann-Prozess. Hatte man sich bis dahin der Diaspora-Juden geschämt, wurden Schoa-Überlebende in Tel Aviv mitunter gar als »Sabon« (Seife) beschimpft, setzte nun ein Umdenken ein. Nach und nach begann die Geschichte der Galut, zum Teil israelischer Identität zu werden. Einer jüdischen Identität. Die ersten israelischen Schulklassen besuchten die Vernichtungslager. Die drohende Auslöschung Israels vor dem Sechs-Tage-Krieg verstärkte diesen Prozess, als aus Kairo unverblümt mit einem neuen Holocaust gedroht wurde. Die Grenzen von 1949 wurden jetzt »Auschwitz-Grenzen« genannt. Heute reden israelische Generäle von Sicherheitsdoktrinen, die »Shoah- proof« sind, eine neuerliche Vernichtung verhindern sollen.
rejudaisierung Dieses neue Selbstverständnis hat auch dazu geführt, dass die jüdische Kultur der Diaspora – einschließlich der des osteuropäischen Schtetls und der deutschstämmigen Jeckes – fast so etwas wie Bestandteil des nationalen Kulturguts Israels geworden ist. Sogar die einst offiziell verfemte jiddische Sprache gehört heute zum gehüteten kulturellen Erbe. Diese Wende erklärt zum Beispiel, warum Israel 2001 die Fresken des von den Deutschen ermordeten Künstlers Bruno Schulz in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus der Ukraine nach Yad Vashem bringen ließ und es dabei mit den ukrainischen Gesetzen nicht so genau nahm. Warum, so die israelische Logik, sollte das Werk eines jüdischen Schoa-Opfers ausgerechnet ukrainisches Nationaleigentum sein? In derselben Logik stellt sich aktuell auch die Frage, warum das Prozess-Manuskript gerade im deutschen Marbach am Ne-ckar aufbewahrt werden soll statt im jüdischen Jerusalem. Auch Albert Einsteins Nachlass befindet sich schließlich seit 1982 in der israelischen Hauptstadt. Und dort ist er recht gut aufgehoben.