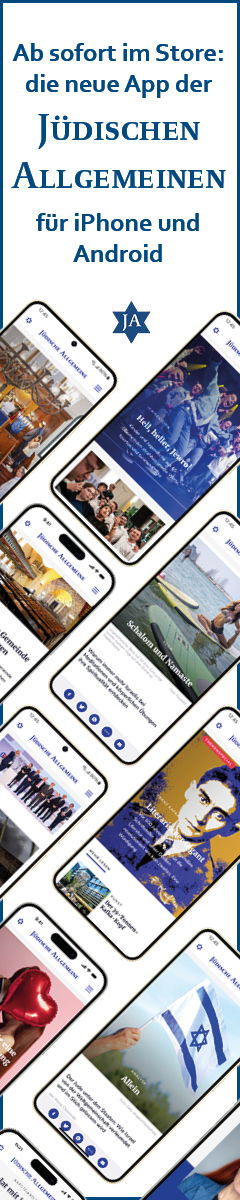von Michael Wolffsohn
Was wir derzeit mit dem bevorstehenden Gefangenenaustausch zwischen Israel und der Hisbollah erleben, ist ein Lehrstück angewandter jüdischer Ethik. Wie das? Schließen militärische Erwägungen und Ethik nicht einander aus? Mitnichten. Richtig ist, dass zwischen beiden eine grundsätzliche Spannung herrscht. Richtig ist auch, dass beide nicht unbedingt, überall und immer zusammenfinden. Richtig ist, dass Gewalt immer nur das allerletzte Mittel der Politik sein darf und politisches Mittel bleiben muss, nie Selbstzweck.
Seitdem der jüdische Staat Besatzungsmacht ist, also seit 1967, ist die Spannung zwischen Ethik und Militär in Israels Armee größer denn je. Mit Ausnahme des Jom-Kippur-Kriegs 1973 und des Libanonfeldzugs 1982, als auch reguläre syrische Soldaten bekämpft wurden, hat es das Land mit Gegnern der besonderen Art zu tun: als Zivilisten getarnte Soldaten, genauer gesagt Guerillas und Terroristen. Werden sie bei der Gefahrenabwehr getötet, steht der Bösewicht von vornherein fest. Es ist derjenige, der Guerillas und Terroristen tötet, sprich vermeintliche Zivilisten: Israel. Diese Kämpfer starten ihre Angriffe zumeist im Wortsinne aus der Mitte der eigenen Bevölkerung heraus. Sie wird als Geisel, als menschliches Schutzschild missbraucht. Wer sich gegen diese »Zivil«-Soldaten wehrt, zum Beispiel Raketenrampen unter Beschuss nimmt, tötet dabei fast zwangsläufig auch wirkliche Zivilisten. Wieder steht der moralische Unhold fest: Israel.
Militärisch kann Jerusalem einen solchen Krieg gewinnen, nicht aber politisch und psychologisch. Das heißt: Letztlich ist ein solcher Kampf gar nicht zu gewinnen. Denn auch die eigene Bevölkerung wird durch die Bilder vom Kampf gegen scheinbar »zivile« Gegner moralisch zermürbt.
Deshalb kommt es für Israel darauf an, moralisch glaubwürdig zu bleiben. Das ist sein pragmatischer Ansatz für den Gefangenenaustausch, bei dem das Verhältnis zwischen dem, was Jerusalem gibt und dem, was es dafür bekommt, nicht stimmt, nicht stimmen kann. Symbolisch und letztlich ethisch signalisiert der jüdische Staat damit: Für das Leben jedes einzelnen Israelis tun wir alles. Wir lassen sogar den Teufel laufen, um unsere Bürger freizubekommen. Denn dass der Preis zu hoch ist, weiß ganz Israel. Es weiß auch, dass dieser Austausch, wie frühere, Anreiz zu weiteren Entführungen und Erpressungen ist (vgl. S. 2).
Neben der pragmatischen gibt es eine religiös-jüdische Ebene: Pikuach Nefesch, die Rettung aus Lebensgefahr beziehungsweise von Menschenleben. Dafür muss alles getan werden. Notfalls dürfen sogar unumstößliche Toravorgaben verletzt wer- den, zum Beispiel das Schabbatgebot. Wer das Neue Testament kennt, erinnert sich an Jesu Streit mit den Pharisäern. Denen entgegnete er: »Der Schabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Schabbat« (Markus 2, 27). Genau diesem »jesua- nischen«, faktisch jüdischen Geist gemäß gebietet der Talmud Pikuach Nefesch. Der religiös-ethische Ansatz wirkt praktisch, politisch und psychologisch: Er motiviert die Bevölkerung, in der und für die dieser Grundsatz gilt. Jeder einzelne Bürger weiß – und seien die einzelnen Politiker auch noch so korrupt oder (wie derzeit Israels Premier Ehud Olmert) der Korruption verdächtig: Mein Staat ist auch für mich da und nicht nur ich für diesen Staat. Lebendig oder tot, ich komme »habaita«, nach Hause.
Auch der preußische Reformoffizier Carl von Clausewitz (1780–1831), der wohl bedeutendste Militärtheoretiker, hebt in seinem Klassiker Vom Kriege hervor, dass die Motivierung der eigenen Bevölkerung, die »Richtungen der Seele«, der Schlüssel zu Sieg oder Niederlage sei. Ethik und Militär sind eben nicht voneinander zu trennen. Deshalb wird, deshalb muss die Hisbollah ebenso wie die Hamas den Krieg militärisch und moralisch und damit »seelisch« verlieren.
Grundsätzlich gilt aber auch: Wer sich heute nicht erpressen lässt, ist auch morgen nicht erpressbar. Hierfür gibt es die große Tradition jüdischer Märtyrer wie Rabbi Meir von Rothenburg (1215–1293), der auf seine Freilassung verzichtete, um der jüdischen Gemeinschaft zusätzliches Leid zu ersparen.
Jetzt wird der Terrorist und doppelte Kindesmörder Samit Kuntar von den Seinen gefeiert. Bald lebt er wohl wieder in Freiheit. Bedarf es eines weiteren Beweises der asymmetrischen Ethik zwischen Israel und seinen Feinden?
Der Autor lehrt als Historiker an der Universität der Bundeswehr in München und ist Mitglied der IKG. Zuletzt erschien von ihm »Juden und Christen – ungleiche Geschwister«.