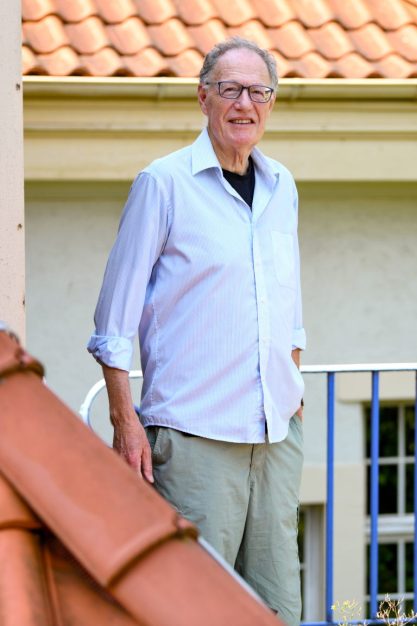Die ersten sechs Jahre meines Lebens bis 1953 habe ich in Israel gelebt. Erst mit Mitte 40 reiste ich dann wieder dorthin. Und nochmal viel später, mit nun 78 Jahren, ist kürzlich mein Buch über die Geschichte meiner Familie erschienen. Viele in meinem Umfeld haben sehr überrascht reagiert. Durch meine Arbeit als Anwalt, langjähriger Stadtrat und meine weiteren politischen Aktivitäten kennen mich in Freiburg viele. Aber ich bin mit meiner Familiengeschichte nie hausieren gegangen. Dass diese Schicksale nun Menschen berühren, bewegt wiederum mich. Das Schreiben war für mich wie ein therapeutischer Prozess, auch die Lesungen wühlen mich auf. Durch das Buch will ich meinen Enkeln einen Zugang zu ihrer Familiengeschichte verschaffen.
Als ich mit Mitte 40 in Tel Aviv vor dem Haus meiner Kindheit stand, zitterte ich vor Aufregung. Ich erinnere mich an eine schöne Kindheit in Tel Aviv. Danach war ich noch mehrmals in Israel, unter anderem auch mit einer Delegation des Freiburger Gemeinderats. Tel Aviv verkörpert für mich die ersten Jahre meines Lebens und den Zufluchtsort meiner Eltern und der Großeltern meiner Mutter. Es ist eine wunderbar schöne und weltoffene, liberale Stadt. Doch mein Verhältnis zu Israel ist zerrissen. Seine Existenz ist natürlich notwendig und unverrückbar – der israelischen Politik aber stehe ich sehr skeptisch gegenüber. Das ist ein sehr vielschichtiges und schwieriges Thema.
Ich erinnere mich an eine schöne Kindheit in Tel Aviv
Für meine Mutter Erna Moos waren ihre Emigrationsjahre in Tel Aviv ihre glücklichste Zeit. Das erzählte sie meiner Frau Rieke. Am Ende dieser Zeit wurde es allerdings schwierig. Beim Einstieg in mein Buch Und nichts mehr wurde, wie es war … schildere ich eine Nacht in Tel Aviv im Oktober 1949. Damals war meine Mutter 33 Jahre alt. Mein 36 Jahre alter Vater Alfred Moos war zum ersten Mal nach dem Nationalsozialismus nach Ulm, in die frühere Heimatstadt meiner Eltern gereist.
Von dem Aussteuergeschäft seiner Eltern am Münsterplatz war nur noch ein Bombenkrater übrig geblieben. Meine Mutter hatte große Angst um meinen Vater. In jener Oktobernacht hörte sie eine innere Stimme, die ihr sagte, dass sie in eine Synagoge gehen müsse. Sie verließ unsere Wohnung in Tel Aviv und irrte herum, später wurde sie in eine psychiatrische Klinik in Haifa gebracht. Ich war damals zwei Jahre und neun Monate alt.
Meine Mutter blieb rund drei Monate in der Klinik, sie erhielt die Diagnose paranoide Schizophrenie. Nach der Rückkehr meiner Eltern nach Ulm folgten weitere Klinikaufenthalte. Erst 1983, nachdem ich als junger Anwalt das frühere Verfahren um »Wiedergutmachung« für meine Mutter noch einmal aufgenommen hatte, wurde ihr Leiden als verfolgungsbedingt anerkannt. Davor wurden diese Zusammenhänge strikt geleugnet.
Das Schreiben war für mich ein therapeutischer Prozess. Die Lesungen wühlen mich auf.
Für den Rest ihres Lebens bis zu ihrem Tod 1994 erhielt sie eine kleine Rente, und für die Zeit von 1949 bis 1983 eine Nachzahlung der Rente. Viel wichtiger aber als das Geld war für meine Mutter, dass nun endlich wahrgenommen wurde, dass ihre Krankheit einen Auslöser hatte und sie zu den vielen Opfern des verbrecherischen Naziregimes gehörte.
Meine Eltern hatten ihre Heimatstadt Ulm 1933 verlassen, mein Vater hatte schweren Herzens sein Jura-Studium abbrechen müssen. Bis 1935 lebten beide in England, dann emigrierte mein Vater nach Palästina, und meine Mutter folgte ihm 1936. Fast alle Verwandten wurden ermordet. Nur den Eltern meiner Mutter gelang es ebenfalls, nach Palästina auszureisen.
Der Vater meiner Mutter nahm sich bald danach im Sommer 1939 aus Verzweiflung über seine Situation das Leben. Seine Frau Frieda, meine Oma, war die einzige Verwandte, die ich als Kind hatte. Sie war eine sehr ernste Frau, zu der ich wenig Zugang fand. Sie ist nie über den Suizid ihres Mannes hinweggekommen. In meiner Kindheit habe ich nicht gefragt, warum ich keine Verwandten hatte. Aber ich spürte, dass bei uns alles anders war als in meinem Umfeld. Der Rückkehr-Entschluss meines Vaters stieß überall auf Befremden. Mein Vater realisierte erst viel später, dass er sich Illusionen gemacht hatte mit seiner Vision, zu einem neuen, besseren Deutschland beitragen zu können.
Wir waren in Ulm alle mit Antisemitismus konfrontiert
Er war ein sehr politischer Mensch und gehörte zu einer linken Minderheit in der SPD, bis er dort 1979 austrat, weil die SPD die nukleare Aufrüstung der NATO akzeptierte. Er unterstützte das Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg in Ulm. Später setzte ich mich in Freiburg für eine ähnliche Einrichtung ein – und es dauerte lange, bis hier im Frühling endlich das Dokumentationszentrum Nationalsozialismus eröffnete. Wir waren in Ulm alle mit Antisemitismus konfrontiert.
Mein Bruder Peter, der 1956 in Ulm geboren wurde, erzählte mir kürzlich von einem Erlebnis, das er mit zehn Jahren hatte: Er spielte mit dem Gartenschlauch und spritzte dabei zu den Nachbarn hinüber. Die Nachbarsfrau schrie wütend: »Scheiß-Juden«. Mein Vater schrieb viele Leserbriefe gegen antisemitische Tendenzen und zeigte einen Ulmer Malermeister an, der in einem Gasthaus gesagt hatte, es sei schade, dass nicht alle Juden vergast wurden. Kurz vor seinem Tod 1997 sagte mein Vater, dass er nicht zurückgekommen wäre, wenn er gewusst hätte, wie es hier war.
Es dauerte lange, bis ich mit meinen Eltern über ihre Vergangenheit sprechen konnte. Erst Mitte der 60er-Jahre fragte ich meinen Vater, wie meine Eltern den Zweiten Weltkrieg überlebt hatten. Es war mir lange unangenehm, dass ich eine jüdische Familie hatte.
Meiner späteren Frau Rieke erzählte ich erst, als ich sie meinen Eltern vorstellen wollte, dass ich aus einer jüdischen Familie kam.
Natürlich führte mein Gefühl, anders zu sein wegen meiner jüdischen Familie und wegen meiner psychisch kranken Mutter, zu Komplexen. Erst allmählich konnte ich mich für meine Familiengeschichte öffnen. Später wurde die Politik meine Ersatzheimat. Doch auch in diesem Umfeld hielt ich meine Herkunft geheim. Meiner späteren Frau Rieke erzählte ich erst, als ich sie meinen Eltern vorstellen wollte, dass ich aus einer jüdischen Familie kam und meine Mutter psychisch krank war. Das war 1974, ich war 27 Jahre alt.
Ich fragte Rieke, ob ihr das etwas ausmache. Es war das erste Mal, dass ich über meine jüdische Herkunft sprach. Rieke und mich verbindet unsere politische Arbeit. Als Jura-Student in Tübingen wurde ich Mitglied im Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS). In Freiburg trat ich dem »Bund kommunistischer Arbeiter« bei und lernte dort Rieke kennen. 1973 war ich bei der Gründung des »Kommunistischen Bunds Westdeutschland« (KBW) dabei. Später fragte ich mich, warum ich die vielen Widersprüche und die Problematik des KBW so lange verdrängt hatte.
1975 wurde ich als Ortssekretär des KBW in Freiburg abgewählt, weil ich dessen Linie zu wenig entsprach. In den 90er-Jahren wurde ich, obwohl ich Parteien gegenüber nun skeptisch war, Mitglied der »Linken« und war ab 1999 für 23 Jahre als Stadtrat der Linken Liste im Freiburger Gemeinderat. 2002 trat ich bei der Oberbürgermeister-Wahl in Freiburg als linker Kandidat an und erhielt 14,3 Prozent der Stimmen. 2009 erfuhr ich, dass ich bis 2013 vom Verfassungsschutz beobachtet worden war. Erst nach 14 Jahren erhielt ich die angeforderten Auskünfte, vieles in den Berichten war geschwärzt – und gespickt mit Fehlinformationen.
Der Hauptgrund aber war mein Wunsch nach Gerechtigkeit
Wahrscheinlich spielte bei meiner Entscheidung für das Jura-Studium auch der erzwungene Abbruch des Jura-Studiums meines Vaters eine Rolle. Der Hauptgrund aber war mein Wunsch nach Gerechtigkeit. Ich wurde Strafverteidiger und war als linker Anwalt für die ganze Region zuständig. Ich arbeitete bald in einer Bürogemeinschaft, ab 1994 in einer politisch orientierten Gemeinschaft im sogenannten Hegarhaus.
Wir wurden eine Anlaufstelle für die Schwachen in unserer Gesellschaft. Ich hatte den richtigen Beruf gewählt und das Gefühl, etwas bewirken zu können. Obwohl ich seit acht Jahren nicht mehr Mitglied unserer Bürogemeinschaft bin, arbeite ich immer noch ein bisschen und verteidige unter anderem Klimaaktivistinnen und -aktivisten.
Nach meinem Ausstieg aus der Bürogemeinschaft mit 70 Jahren hatte ich genug Freiraum, um mein Buch zu schreiben. Anfangs wollte ich mich auf die Geschichte meiner Familie konzentrieren. Doch dann merkte ich, dass auch die Entwicklung meines Lebens dazugehört. Auch sehr persönliche Themen wie meine Ehe und unsere Familie mit unseren drei Kindern habe ich mit aufgenommen. Mir wurde noch einmal bewusst, dass es stimmt, dass das Private politisch ist.
Wir wurden eine Anlaufstelle für die Schwachen in unserer Gesellschaft
Wahrscheinlich spielte bei meiner Entscheidung für das Jura-Studium auch der erzwungene Abbruch des Jura-Studiums meines Vaters eine Rolle. Der Hauptgrund aber war mein Wunsch nach Gerechtigkeit. Ich wurde Strafverteidiger und war als linker Anwalt für die ganze Region zuständig. Ich arbeitete bald in einer Bürogemeinschaft, ab 1994 in einer politisch orientierten Gemeinschaft im sogenannten Hegarhaus.
Wir wurden eine Anlaufstelle für die Schwachen in unserer Gesellschaft. Ich hatte den richtigen Beruf gewählt und das Gefühl, etwas bewirken zu können.
Obwohl ich seit acht Jahren nicht mehr Mitglied unserer Bürogemeinschaft bin, arbeite ich immer noch ein bisschen und verteidige unter anderem Klimaaktivistinnen und -aktivisten.
Nach meinem Ausstieg aus der Bürogemeinschaft mit 70 Jahren hatte ich genug Freiraum, um mein Buch zu schreiben. Anfangs wollte ich mich auf die Geschichte meiner Familie konzentrieren. Doch dann merkte ich, dass auch die Entwicklung meines Lebens dazugehört. Auch sehr persönliche Themen wie meine Ehe und unsere Familie mit unseren drei Kindern habe ich mit aufgenommen. Mir wurde noch einmal bewusst, dass es stimmt, dass das Private politisch ist.
Wahrscheinlich spielte bei meiner Entscheidung für das Jura-Studium auch der erzwungene Abbruch des Jura-Studiums meines Vaters eine Rolle. Der Hauptgrund aber war mein Wunsch nach Gerechtigkeit. Ich wurde Strafverteidiger und war als linker Anwalt für die ganze Region zuständig. Ich arbeitete bald in einer Bürogemeinschaft, ab 1994 in einer politisch orientierten Gemeinschaft im sogenannten Hegarhaus.
Wir wurden eine Anlaufstelle für die Schwachen in unserer Gesellschaft. Ich hatte den richtigen Beruf gewählt und das Gefühl, etwas bewirken zu können. Obwohl ich seit acht Jahren nicht mehr Mitglied unserer Bürogemeinschaft bin, arbeite ich immer noch ein bisschen und verteidige unter anderem Klimaaktivistinnen und -aktivisten.
Mir wurde noch einmal bewusst, dass es stimmt, dass das Private politisch ist
Nach meinem Ausstieg aus der Bürogemeinschaft mit 70 Jahren hatte ich genug Freiraum, um mein Buch zu schreiben. Anfangs wollte ich mich auf die Geschichte meiner Familie konzentrieren. Doch dann merkte ich, dass auch die Entwicklung meines Lebens dazugehört. Auch sehr persönliche Themen wie meine Ehe und unsere Familie mit unseren drei Kindern habe ich mit aufgenommen. Mir wurde noch einmal bewusst, dass es stimmt, dass das Private politisch ist.
Aufgezeichnet von Anja Bochtler