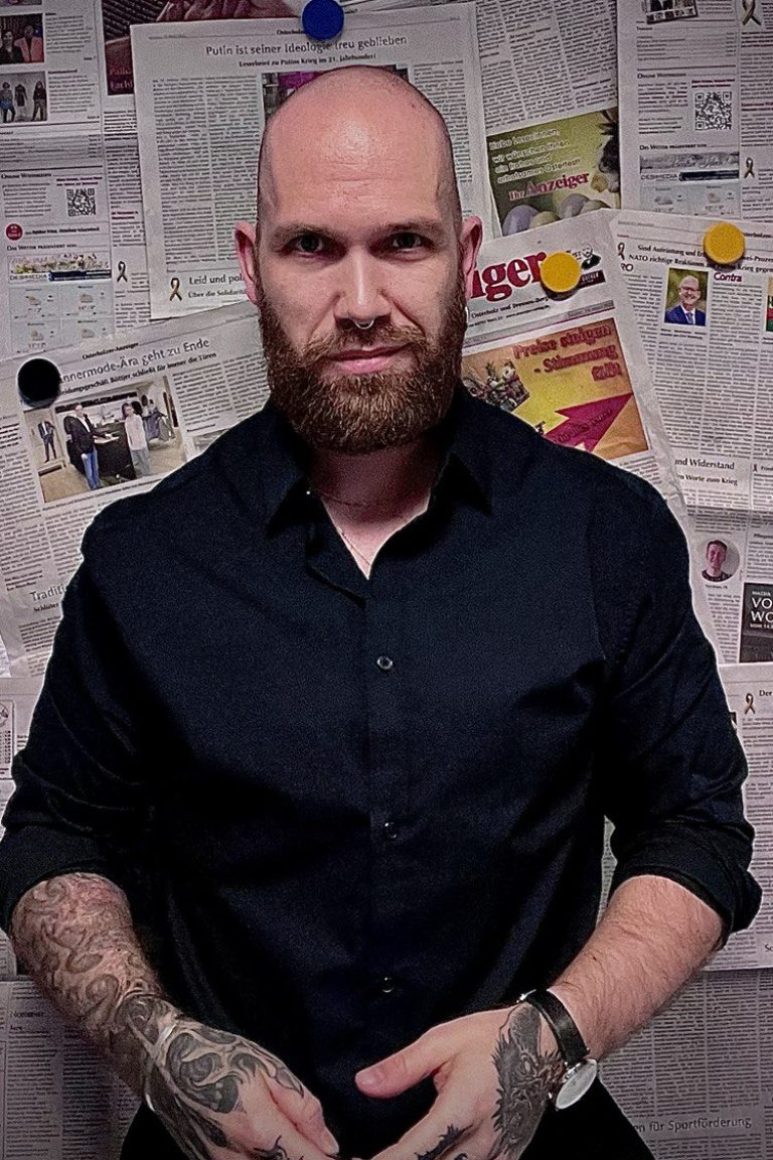Eine Lehramtsstudentin im Praxissemester wandte sich nach dem 7. Oktober 2023 an Karim Fereidooni, Professor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Universität Bochum. Ihr Schulleiter habe es verboten, im Unterricht über das Massaker und den Nahost-Konflikt zu sprechen. Für Fereidooni, der bereits vor dem 7. Oktober für das Land NRW Antisemitismus als soziales Phänomen im Schulkontext untersuchte, eine absurde Anweisung.
Im Interview mit »Belltower News« erklärt er: »TikTok und Co. hören ja auch nicht auf, die Videos hören nicht auf zu existieren und die Propaganda, die da zum Teil virulent ist, hört nicht auf.« Lehrkräfte, besonders im Fach Politik, müssten »sprechfähig sein«, um Antisemitismus entschieden zu begegnen. Doch viele seien es nicht – aus Unsicherheit und mangelnder Kenntnis. Das sei besonders problematisch, weil seit dem Terrorangriff der Hamas antisemitische Vorfälle und Israelfeindlichkeit an deutschen Schulen zugenommen hätten – sehr zur Verängstigung jüdischer Eltern und Schüler.
Fereidoonis Handlungsempfehlungen
Vor diesem Hintergrund legte Fereidooni »50 Handlungsempfehlungen für Lehrer*innen« zum Umgang mit dem Hamas-Terror, dem Gazakrieg und dem Nahostkonflikt vor. Medien, Bildungsnetzwerke und Institutionen reagierten positiv. Doch das sagt mehr über das gesellschaftliche Verhandlungsklima von Antisemitismus und Israelhass aus als über die Qualität der Handlungsempfehlungen.
Denn diese weisen in Teilen erhebliche Schwächen auf: sachliche Fehler, tendenziöse Geschichtsdarstellung, fehlende Praxistauglichkeit und eine angebliche Ausgewogenheit, die eine falsche Symmetrie im Nahostkonflikt suggeriert. All das erschwert eine klare Haltung und konsequentes Handeln von Lehrkräften gegen Antisemitismus.
Statt Orientierung zu bieten, liefern die Empfehlungen vor allem ein »emotionales Entlastungsangebot«, so die treffende Kritik des Forschungsverbunds EMPATHIA³, der Lehrer und Polizisten im Umgang mit Antisemitismus professionalisieren will. Verfasst wurde der Text von Jakob Baier, Florian Beer, Marc Grimm, Jana Habig, Andreas Stahl und Volker Beck, dem Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und Geschäftsführer des Tikvah Instituts, mit dem EMPATHIA³ zusammenarbeitet. Weitere Kooperationen bestehen unter anderem mit der Ruhr Universität Bochum.
Der Verbund erkennt die guten Absichten der Empfehlungen an. Und einige der komplett in achtsamer Ich-Form formulierten Handlungsempfehlungen sind für sich genommen auch nützlich – etwa die Forderung, den 7. Oktober als Terrorismus zu verurteilen und für das Existenzrecht Israels einzutreten. Insgesamt jedoch, so der Hauptkritikpunkt der EMPATHIA³-Autoren, verkenne Fereidoonis Papier die schulischen Konfliktlagen und verzerre Problemfelder in der Auseinandersetzung mit dem Nahostkonflikt und Antisemitismus.
Sein – von den Kritikern geteilter – Anspruch, allen Schülerperspektiven gerecht werden zu wollen, schlage in die vereinfachende Äquidistanz um, »allen gleichermaßen recht zu geben – den Schüler*innen wie den Konfliktparteien des Nahost-Konfliktes«. Dass dieser Ansatz jüdischen Schülern nicht mehr Sicherheit bietet, sondern deren Verängstigung nur subtiler betreibt, arbeiten die EMPATHIA³-Autoren auf mehreren Ebenen überzeugend heraus.
Empathische Verzerrung der Realität
Fereidoonis Appell an Lehrkräfte, empathisch zu sein, Empathie unter Schülern zu fördern und Haltung zu zeigen, resultiert in der Forderung, sich nicht für eine Seite zu positionieren, sondern die komplexen Perspektiven und die »gegenseitigen Verletzungsverhältnisse der letzten 80 Jahre« zu berücksichtigen, wie er schreibt. Dies führe jedoch, so die Kritik von EMPATHIA³, unter anderem zu einer problematischen »Parallelisierung von Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus«.
Diese suggeriere fälschlicherweise nicht nur, dass jüdische und muslimische Schüler gleichermaßen Opfer der jeweils anderen Gruppe sowie gleichsam Repräsentanten des arabisch-israelischen Konfliktes und Opfer der Konfliktauswirkungen in Deutschland seien. Die nahegelegte Symmetrie von Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus verkenne zudem die hohen Zustimmungsraten zu antisemitischen Positionen unter Muslimen sowie die zugespitzte Bedrohungslage nach dem 7. Oktober für jüdische Schüler, für die Beleidigungen und Bedrohungen durch muslimische, aber auch nicht-muslimische Mitschüler mittlerweile zum Alltag gehören.
Problematisch ist für den Forschungsverbund auch Fereidoonis Darstellung des Nahostkonflikts.
Ein Blick auf die Zahlen bestätigt nicht nur die Angemessenheit der Kritik von EMPATHIA³. Sie zeigen auch, dass Fereidoonis Ausgewogenheit eine Form der Realitätsausblendung darstellt. So hat die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus für das Jahr 2024 bundesweit 284 antisemitische Vorfälle an Schulen dokumentiert, darunter 19 Angriffe. Zum Vergleich: 2023 wurden 255 Vorfälle erfasst, 2022 waren es noch 86. Übergriffe von jüdischen Schülern auf muslimische Schüler sind dagegen bislang nicht dokumentiert.
Forschungsergebnisse zur Radikalisierung des antizionistischen Antisemitismus lässt Fereidooni außer Acht. Stattdessen behauptet er kontrafaktisch, Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus ähnelten sich funktionslogisch, und zwar nach dem Prinzip »teile und herrsche«. Diese sowohl vage bleibende als auch hinter jeden Forschungsstand zurückfallende Behauptung verneble, wie die EMPATHIA³-Autoren richtigerweise anmerken, nicht nur das Verhältnis von Rassismus und Antisemitismus. Sie sei auch anschlussfähig für Verschwörungstheorien, da hier eine unbestimmt bleibende Gruppe imaginiert werde, die Rassismus und Antisemitismus zum eigenen Vorteil einsetze. Und ein Blick in seine Handlungsempfehlungen bestätigen den Vorwurf: Fereidoonis Aufklärung über Antisemitismus ist dessen Verklärung, die zugleich unbewusste Ressentiments anspricht.
Unausgewogene Ausgewogenheit
Problematisch ist für den Forschungsverbund auch Fereidoonis Darstellung des Nahostkonflikts. Zum einen werde der Zeitraum willkürlich auf 80 Jahre eingegrenzt, was das Verständnis der vielschichtigen historischen Zusammenhänge erheblich erschwere. Zum anderen werde die Geschichte lückenhaft dargestellt. Die Vertreibung von Palästinensern wird erwähnt, nicht jedoch der Angriffskrieg arabischer Staaten gegen Israel oder die Vertreibung von etwa 900.000 Juden aus arabischen Ländern. Dadurch entstehe ein einseitiges Bild, so die schlüssige Kritik. Zumal Fereidooni auch keine Begründungen für seine Eingrenzung und Auslassungen liefert.
Fereidooni verwechselt den Internationalen Gerichtshofs mit dem Internationalen Strafgerichtshof.
Darüber hinaus werfen die Forscher Fereidooni zu Recht vor, dass seine Gegenüberstellung muslimischer und jüdischer Schüler eine rein religiöse Deutungsebene suggeriere, die der politischen und historischen Komplexität nicht gerecht werde. Damit reduziere Fereidooni Schüler auf Herkunft und Religion. Es müsse aber laut EMPATHIA³ darum gehen, Schüler dazu zu befähigen, sich »selbstkritisch mit den Narrativen der eigenen Sozialisation auseinanderzusetzen und ergebnisoffen zu einem Urteil zu kommen«. Fereidooni entzieht jedoch, so lässt sich weitergehend festhalten, die über Herkunft und Religion vermittelten problematischen Narrative weitgehend der Kritik.
Schließlich weisen die Handlungsempfehlungen auch sachliche Fehler auf. Der Verweis auf den »Genozid-Vorwurf« gegen Israel beispielsweise verwechselt den Internationalen Gerichtshofs mit dem Internationalen Strafgerichtshof.
Solche Auslassungen und Fehler erschwerten es Lehrkräften, zu einer fundierten Urteilsbildung zu kommen, so das treffende, abschließende Urteil von EMPATHIA³.
Bildung mit Haltung
Der Forschungsverbund begnügt sich jedoch nicht mit Kritik, sondern legt seinerseits konkrete Empfehlungen für den schulischen Umgang mit Antisemitismus und dem Nahostkonflikt vor. Im Zentrum steht langfristig eine präventive Bildungsarbeit, die Antisemitismus historisch kontextualisiert, seine Erscheinungsformen aufzeigt und ihn als »negative Leitidee der Moderne« (Samuel Salzborn) begreifbar macht.
Dazu gehöre auch die Förderung von Medien- und Quellenkompetenz sowie die kritische Auseinandersetzung mit individuellen und gesellschaftlichen Ursachen judenfeindlicher Einstellungen. Ziel müsse eine demokratische, kooperative Schulkultur sein, in der Antisemitismus nicht nur erkannt, sondern auch konsequent bekämpft wird – gestützt durch gut ausgebildete Lehrkräfte und ein sensibilisiertes Schulpersonal. Die Autoren betonen die Notwendigkeit, die Geschichte des Nahen Ostens, des Zionismus und des Staates Israel sachlich und multiperspektivisch in den Unterricht zu integrieren – auch jenseits aktueller Konflikte. Nur wer über solides Wissen verfügt und in einer offenen Debattenkultur geschult ist, könne Vorurteile abbauen und ein respektvolles Miteinander ermöglichen.
Gleichzeitig fordert der Forschungsverbund klare, konsequente Reaktionen auf antisemitische Vorfälle im Schulalltag. Entsprechende Äußerungen sollen nicht relativiert, sondern deutlich benannt und verurteilt werden. Lehrkräfte müssten die Wirkungsweise antisemitischer Aussagen erklären und dabei auch die Emotionen aller Beteiligten ernst nehmen.
Die Dokumentation solcher Vorfälle, ihre Besprechung im Kollegium und die Meldung an die Schulleitung gehören laut EMPATHIA³ zur professionellen Reaktion. Bei strafrechtlich relevanten Handlungen wie Holocaustleugnung oder Volksverhetzung seien zudem rechtliche Schritte unverzichtbar.
Das Gegenteil von Bildung
Die Kritik des Forschungsverbunds EMPATHIA³ ist nicht nur eine empirisch und didaktisch fundierte Korrektur an Fereidoonis Handlungsempfehlungen, sondern nimmt – anders als Fereidooni – die antisemitische Bedrohungslage für jüdische Schüler ernst. Darüber hinaus zeigt sie nachvollziehbar, wie gut gemeinte pädagogische Ansichten, insbesondere Empathie- und Harmonieorientierung, die Situation für jüdische Schüler verschärfen können.
Die EMPATHIA³-Autoren lehnen Empathie im Bildungskontext aber keineswegs ab – im Gegenteil: Sie verfolgen selbst einen empathiebasierten didaktischen Zugang zu ihren Zielgruppen, wie es auf der Homepage des Verbunds heißt. Wenn Einfühlung jedoch konfliktscheu und die Realität um der Harmonie willen verbogen wird, damit am Ende alle irgendwie Täter und Opfer zugleich sind, dann behindert Empathie Bildung und befördert ihr Gegenteil: die Zerrüttung des Urteilsvermögens, Konformismus und Ressentiment – allesamt Voraussetzungen des Antisemitismus.
Der Pädagoge Andreas Gruschka formulierte einst, der Widerspruch der warmen Pädagogik, die sich dem Menschen ungeteilt und unvermittelt zuwendet, bestehe darin, dass sie in ihrer Unmittelbarkeit die objektiven Ursachen seines Leids ausblende – und daher selbst kalt sei. Fereidoonis Ansatz ist nicht weniger widersprüchlich und kalt. Der ausgewogene, empathische und unmittelbar menschlichere Charakter seiner Handlungsempfehlungen blendet letztlich das Leiden jüdischer Schüler aus, das ihn doch dazu animierte, sie zu verfassen.
Dr. Marc Jacobsen ist Soziologe und forscht zu Antisemitismus, Nationalismus und Globalisierung. Zudem ist er als Berater gegen Rechtsextremismus tätig.
Patrick Viol ist Chefredakteur des Osterholzer/Bremervörder Anzeigers und schreibt nebenbei für die Jungle World und die taz. Er ist Mitherausgeber und Autor des Buches »Halbbildung. Kritische Theorie der Pädagogik«, das im April im Verbrecher Verlag erschienen ist.