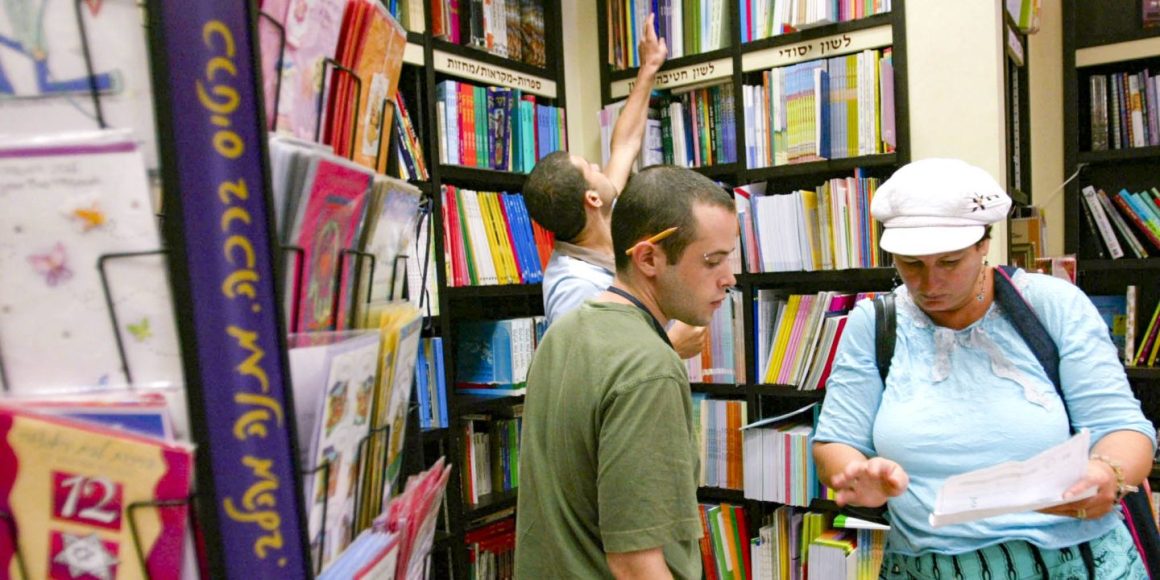Auf die oft und gern gestellte Frage »Was ist jüdische Literatur?« gibt es bekanntermaßen keine eindeutige Antwort. Handelt es sich, unabhängig vom Inhalt, um literarische Texte, die von Jüdinnen und Juden geschrieben wurden? Oder handelt es sich vielmehr um Texte von Jüdinnen und Juden zu jüdischen Themen beziehungsweise um Texte über jüdisches Leben?
Gehören Texte zu jüdischen Themen, die von Nichtjuden verfasst wurden, auch zur jüdischen Literatur? Ist Lessings Nathan der Weise jüdische Literatur? Oder Kafkas Romane? Was ist mit dem Werk von Elfriede Jelinek, die selten als Jüdin wahrgenommen wird, aber zum Teil jüdischer Herkunft ist, was ihre Biografie und Wahrnehmung zweifellos geprägt hat?
Darüber und über ähnliche Fragen wurde viel nachgedacht, gestritten und viel geschrieben. Selten hingegen wurde die Frage gestellt, wie man sich als Jude oder Jüdin beim Lesen seiner jüdischen Wurzeln besinnt. Lesen Sie jüdisch? Lesen – ich spreche hier natürlich vor allem von literarischen und essayistischen Texten – ist stets eine Interaktion zwischen eigener Identität und der daraus resultierenden Wahrnehmung und einer Außenwelt, die durch Texte gespiegelt, verzerrt, gebrochen und interpretiert wird.
Schon als Kind habe ich darauf geachtet, wie jüdische Figuren dargestellt werden.
Zur »Außenwelt« gehört in diesem Zusammenhang auch die Innenwelt jener, welche die infrage kommenden Texte verfasst haben. Lesen bereichert nicht nur, es prägt und verändert, und wer bewusst liest, setzt sich dabei immer auch mit dem eigenen Selbst auseinander.
Hätte man mich als Jugendlichen oder jungen Erwachsenen gefragt, wie sich meine jüdische Herkunft auf meine Leseerlebnisse, Leseerfahrungen, die Wahl der gelesenen Texte oder die Wahrnehmung derselben auswirkt, hätte ich darauf verwiesen, dass ich schon als Kind stets darauf geachtet habe, wie jüdische Figuren in den Geschichten, die ich las, dargestellt werden und wie ich mich immer – ob diese nun positiv oder negativ gezeichnet waren – mit ihnen identifizierte.
Antisemitische oder klischeehafte Schilderungen
Auch bei eindeutig antisemitischen oder klischeehaften Darstellungen von Juden, wie zum Beispiel in Walter Scotts Roman Ivanhoe, freute ich mich, wenn der Autor hin und wieder doch ein positives Wort über Isaak, den geizigen, alten Juden, verlor, der in diesem Roman eine wichtige Nebenrolle spielt. Im Falle von Charles Dickensʼ Fagin in Oliver Twist wartete ich allerdings vergebens auf etwas Positives über diese im Buch oftmals nur als »der Jude« bezeichnete Romanfigur.
Es tat mir weh, dass viele meiner Lieblingsschriftsteller unter den Klassikern der Weltliteratur Juden fast ausschließlich negativ oder klischeehaft bis rührselig darstellten. Insbesondere »große Russen« wie Puschkin, Dostojewski oder Solschenizyn verwendeten antisemitische Zuschreibungen genauso selbstverständlich wie frauenfeindliche oder nationalistische.
Ich liebte diese Autoren trotzdem und versuchte, die menschenverachtenden Passagen zu ignorieren. Das gelang mir allerdings nur selten. Als Migrant waren zeitweise Bücher, vor allem solche in meiner Muttersprache Russisch, meine besten Freunde. Bei jeder antisemitischen Passage, die ich las, hatte ich den Eindruck, gute Freunde würden sich von mir abwenden.
Keine verehrungswürdigen Vorbilder
Was haben diese Leseerfahrungen bewirkt? In erster Linie, dass ich weder damals noch später, als ich selbst zu schreiben begann, verehrungswürdige Vorbilder hatte, denen ich als Schriftsteller nacheiferte – weder jüdische noch nichtjüdische. Es gab und gibt Autorinnen und Autoren, die ich sehr schätze, von denen ich viel gelernt habe und denen ich dankbar bin, doch ist mir schon sehr früh klar geworden, dass hinter jeder (realen oder vermeintlichen) moralischen Instanz bei genauerem Hinschauen stets auch ein fehlbarer Mensch wie ich selbst erkennbar wird. Dieser Eindruck hat sich noch verstärkt, als ich das Glück hatte, einige der von mir bis dahin bewunderten Kolleginnen und Kollegen persönlich kennenzulernen.
Menschen oder Bücher können mir Kraft geben und den Weg weisen, den ich allein gehen muss.
In letzter Konsequenz verweile ich als Autor einsam und allein vor einem Bildschirm oder einem Blatt Papier. Dabei muss ich nicht nur jedes Mal eine neue literarische Welt erschaffen, sondern immer wieder auch die Fragen nach Recht und Unrecht, nach Identität und Zugehörigkeit stellen. Andere Menschen oder Bücher können mir Kraft geben und den Weg weisen, den ich dann allerdings allein gehen muss. Ob diese Erkenntnis auf meine jüdischen Wurzeln, die daraus resultierenden Erlebnisse in verschiedenen Ländern und auf meine Leseerfahrungen zurückzuführen ist? Nicht nur, aber wohl doch zu einem großen Teil.
Heute beeinflusst meine jüdische Identität vor allem den Inhalt meiner schriftstellerischen Produktion. Das bezieht sich nicht primär auf die Wahl sogenannter jüdischer Themen, sondern auf jene existenziellen Überlegungen, die als Folge meines eigenen jüdischen Schicksals, der damit verbundenen Unsicherheit, der Migration und der Unbehaustheit fast selbstverständlich auftauchen und nach einer angemessenen, für ein Lesepublikum interessanten literarischen Form verlangen. Inwieweit mir das gelingt, mögen andere beurteilen.
Der Autor, geboren 1966 in Leningrad, lebt als freier Schriftsteller in Salzburg. Zuletzt erschien sein Roman »Die Heimreise« (Residenz Verlag).