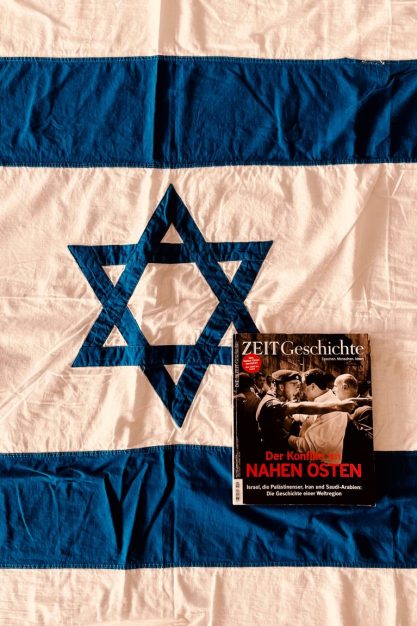Das klingt reichlich ambitioniert. »Wer den Nahostkonflikt verstehen will, muss seine Geschichte entwirren«, betont Frank Werner. »Unser Heft schildert den Konflikt von seinen Anfängen an – und in all seinen Dimensionen«, so der Chefredakteur des Magazins »ZEIT Geschichte« der gleichnamigen Wochenzeitung, das sich diesmal Israel, den Palästinensern sowie dem Iran, Syrien und Saudi-Arabien widmet.
Doch bereits die Überschrift des Editorials verursacht Stirnrunzeln. Sie lautet: »Der ewige Brandherd«. Assoziativ liegt dies gefährlich nah an »Der ewige Jude«, einer Gestalt aus der christlichen Legendenbildung des Mittelalters, die später von der NS-Propaganda aufgegriffen wurde.
Aber auch andere Begriffe irritieren.
So würden die Mullahs »den antizionistischen Kampf« predigen, was den eliminatorischen Antisemitismus, der zur Staatsdoktrin des Iran gehört, verharmlost oder sogar ausblendet. Und Sätze wie »Gewalt nährt Gewalt, die alte Logik des Schreckens« sind nichts anderes als die bereits 100-mal zum Thema gehörten Phrasen. Es fehlt nur die berühmte »Gewaltspirale«.
Orientierung Selbstverständlich können auf 122 Seiten allenfalls einige Momentaufnahmen und grobe Entwicklungslinien gezeigt werden, weshalb sich das Heft an ein Publikum richtet, das etwas mehr über die Region erfahren will, als täglich in den Medien zu finden ist, aber dabei Orientierungshilfe benötigt. Genau dafür eignet sich das Magazin durchaus – zumindest teilweise.
Die Vertreibung von weit über 800.000 Juden aus der arabischen Welt wird mit keinem Satz erwähnt.
Seine Macher konnten einige wirklich namhafte Autoren gewinnen, allen voran den deutsch-israelischen Historiker Dan Diner, der in einem Gespräch erläutert, welchen Stellenwert die Schlacht von El Alamein für das Überleben des Jischuws, der vorstaatlichen jüdischen Gemeinschaft in Palästina, einnahm und aus welchen Gründen diese im historischen Gedächtnis im späteren Israel in den Hintergrund rückte.
Auch der Beitrag von Gisela Dachs ist ein Glücksgriff. »Ein Traum im Sand« heißt er und skizziert abseits aller Klischees die Genese von Tel Aviv, wobei die Biografie von Meir Dizengoff so etwas wie der erzählerische rote Faden ist. Denn seine politische Sozialisation erfuhr der legendäre erste Bürgermeister der Stadt in Odessa, weshalb die Metropole am Schwarzen Meer für ihn auch Vorbildcharakter in seinen urbanen Konzeptionen einnahm. 1921 wird Tel Aviv von der britischen Mandatsmacht schließlich der Status einer eigenständigen Kommune verliehen.
»Es ist die erste jüdische Regierung in Palästina: Sie zieht eigene Steuern ein, ein eigenes Erziehungs- und Gesundheitssystem entsteht«, weiß die Professorin an der Hebräischen Universität seine Agenda zu berichten.
Erich Follaths Text »Die versuchte Versöhnung« ist ebenfalls stark biografisch gefärbt. So porträtiert der Publizist die früheren Regierungschefs Menachem Begin und Yitzhak Rabin, um so auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden lange Zeit in Israel dominanten politischen Blöcke zu verweisen, und zwar den sozialistisch angehauchten Zionismus, für den die Arbeitspartei stand, sowie den Revisionismus, aus dem der Likud hervorging.
MANKO Das liest sich alles so informativ wie auch spannend. Nur wirkt es etwas aus der Zeit gefallen. Denn längst ist die israelische Parteienlandschaft stark segmentiert. Oder Akteure wie die Arbeitspartei erlebten einen massiven Bedeutungsverlust, weshalb gerade in den vergangenen Jahren Regierungsbündnisse noch weniger Bestand hatten als früher und das politische System in Israel in eine Krise gestürzt ist. Dummerweise erfährt man im ganzen Heft so gut wie nichts über diese relevanten Entwicklungen und deren Ursachen. Das ist definitiv ein Manko.
Manches in dem Magazin wirkt etwas angestaubt, womit nicht nur das Fotomaterial gemeint ist.
Manches in dem Magazin wirkt daher etwas angestaubt, womit nicht nur das Fotomaterial gemeint ist. Doch einige Sachen sind ärgerlich. Wenn mit den Zeilen »Handarbeit – Schnur und Lederbeutel werden für die Palästinenser zur Waffe: Steinschleuder aus der Zeit der Zweiten Intifada« ein Bild aus jenen Jahren gezeigt wird, dann entsteht der Eindruck, dass damals allenfalls ein paar Steine flogen.
Die Tatsache, dass die Palästinenser den suizidalen Terror perfektionierten, wird auf diese Weise komplett ausgeblendet. Und warum schreibt ein Autor wie Ralf Zerback in einem Magazin zum Thema Nahostkonflikt, obwohl sein eigentliches Kompetenzfeld das Münchner Stadtbürgertum des 19. Jahrhunderts ist?
»nakba« Ohne Frage gehört die Beschäftigung mit den Palästinensern, die 1948 und 1967 fliehen mussten, in ein solches Heft. Und der Historiker Joseph Croitoru nimmt sich dankenswerterweise auch der Entstehungsgeschichte des Begriffs »Nakba« an und verweist auf dessen Instrumentalisierung. Doch wenn einem die Historie des Nahostkonflikts in »all seinen Dimensionen« versprochen wird, wie kann es sein, dass mit keinem einzigen Satz die Vertreibung von weit über 800.000 Juden aus der arabischen Welt erwähnt wird?
Genau aus diesen Gründen ist das Gefälle zwischen den einzelnen Beiträgen recht groß, weshalb das Magazin einen eher zwiespältigen Eindruck hinterlässt.
»ZEIT Geschichte 2/23: Der Konflikt im Nahen Osten – Israel, die Palästinenser, Iran und Saudi-Arabien: Die Geschichte einer Weltregion«. 122 S., 8,95 €