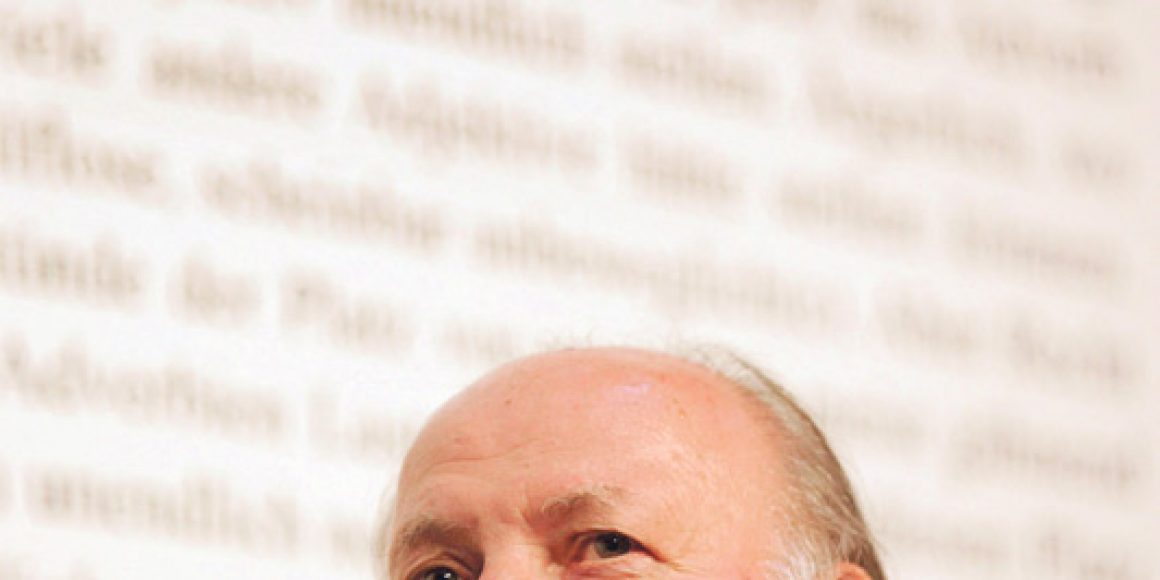Geplant war ein vielschichtiger Roman mit mehreren Handlungsebenen über eine Kunstfigur. Entstanden ist eine Zusammenstellung von Tagebucheinträgen vom 1. Januar 2001 bis 29. Juli 2009. Aufzeichnungen eines Mannes, der gegen eine unerbittlich fortschreitende Krankheit (Parkinson), den zunehmenden Verfall seiner Kräfte und gegen die ihn bedrückenden Zustände seiner ungarischen Heimat anschreibt, während er sich um die Herstellung eines literarischen Kunstwerks bemüht, dessen Fragment in der Mitte des Buches platziert ist.
Persönliche Erlebnisse, tagespolitische Analysen, existenzielle Überlegungen wechseln sich in kaleidoskopischer Vielfalt mit grimmigen Beobachtungen und witzigen Aperçus ab, zusammengehalten durch die literarische Gestaltungskraft und starke Persönlichkeit ihres Autors.
James bond Die schwierige Beziehung zum bewunderten Komponisten György Ligeti, seine warme Freundschaft zum Pianisten András Schiff, die schönen Abende mit den Barenboims, bei denen der Dirigent ein Libretto von ihm fordert, sehr offene Einschätzungen anderer Autoren und Schriftsteller, sogar eine Kritik des James-Bond-Films Goldfinger, den Kertész, als einer, der den größten Teil seines Leben hinter dem Eisernen Vorhang zugebracht hat, nun im Januar 2002 zum ersten Mal im Fernsehen sieht: »Ein unglaublicher dummer Film. (…) und als ich den Kopf am heftigsten schüttelte, wurde mir auf einmal klar, dass der Film, den ich sehe, wahr ist. Ist nicht eben das am 11. September vergangenen Jahres geschehen, hat diese Bin Laden genannte Märchenfigur ihre Ideen nicht aus solchen schwachsinnigen amerikanischen Drehbüchern geschöpft (…)?«
Es ist das Fehlen jeglichen Selbstmitleids, die Lebensfreude, die Kertész’ Notizen, des düsteren Gegenstands und vorhersehbaren Ausgangs zum Trotz, so lesenswert machen. Die guten Restaurants, die er gerne besucht, die Reisen, die er, auch wenn sie ihn anstrengen, nach langen Jahren des Eingesperrtseins stets aufs Neue genießt. »So muss man leben – wenn ein Freund ein Konzert in Salzburg gibt, setzt man sich in den Zug und fährt hin.«
In ihrer Unerbittlichkeit erschreckende Selbstbeobachtungen: »Wer liebt mich? (Außer mir selbst?) Ich glaube, niemand. Ich bin auch nicht liebenswert. Letzten Endes will ich auch nicht, dass man mich liebt, ich begnüge mich auch mit Bewunderung.« Die Vorzüge und Schattenseiten eines Daseins als Nobelpreisträger: »Wenn ich noch lange lebe, werde ich am Ende noch zur Kultfigur, obwohl ich nicht zum Segenspenden unter die Menschen gegangen bin, sondern um ihnen von meinen Erfahrungen zu berichten.« Der zunehmende körperliche Kontrollverlust, der sein existenzielles Selbstverständnis infrage stellt: »Was ich bin, wenn ich nicht schreibe: nichts und niemand.«
heimat Das komplizierte Verhältnis zu Ungarn, wo er sich ebenso ausgestoßen fühlt wie seinerzeit Béla Bartók: »Er nährt sich aus ungarischen Wurzeln und bleibt in Ungarn ein Fremder. (…) Ich will damit nur sagen, dass hier jeder heimatlos ist, der zeitgemäße Wahrheiten in einer zeitgemäßen Sprache anbietet.« Ungarn – wo man ihn im Sozialismus kaum wahrnehmen wollte, um ihn, mit zunehmender Bekanntheit, im Sinne der neu erworbenen Meinungsfreiheit heftig und gemein zu beschimpfen. »Sie hassen dich, weil du Jude bist, sie hassen dich, weil du glücklich bist, sie hassen dich, weil du anderswo geschätzt wirst – sie hassen dich, weil du existierst.«
Die eigene Position in der internationalen Literatur beschreiend, rechnet sich Kertész in der Nachfolge Kafkas und Celans der »in Osteuropa in Erscheinung getretenen jüdischen Literatur (zu), die (…) hauptsächlich auf Deutsch, aber nie in der Sprache der jeweiligen nationalen Umgebung geschrieben wurde.« Was ihn nicht daran hindert, sich eingehend mit den Eigenheiten und Vorzügen seines eigentlichen literarischen Instruments, der ungarischen Sprache, auseinanderzusetzen.
Den Antisemitismus, der im Programm der schon damals drittstärksten politischen Kraft (MIÉP) Ungarns seinen Niederschlag findet: »Was ist Antisemitismus? Das in Mord ausartende Gaudi schmutziger Seelen.« Schlussfolgerung: »Die europäischen Juden begehen meines Erachtens einen selbstmörderischen Fehler, wenn sie in das Geheul von europäischen Intellektuellen und Chefbeamten einstimmen, die sie gestern noch ausrotten wollten und jetzt unter dem Vorwand der Kritik an Israel eine neue Sprache für den alten Antisemitismus finden; wieso sollten sich ihre Absichten denn geändert haben.«
Immer präzise, stets nuanciert, um die Zwischentöne bemüht, die durch den Abdruck einiger weniger Schlagworte oder Interviewäußerungen gern verwischt werden, ist die Letzte Einkehr, gerade in ihrer von Kertész selbst bemängelten »Stillosigkeit«, ein sehr lesenswertes Buch. Als Ausdruck einer selbst durch den Ausblick auf das eigene Ende nicht zu brechenden Lebensbejahung, die, auch wenn Kertész Generalisierungen entschieden ablehnt – »›Jude‹ ist nur für den Antisemiten eine eindeutige Kategorie« –, in ihrem Witz wie in ihrem Scharfsinn, in ihrer Trauer wie in ihrer Selbstbezogenheit und Selbstironie, als zutiefst jüdisch zu bezeichnen ist.
Imre Kertész: »Letzte Einkehr. Tagebücher 2001–2009«. Deutsch von Kristin Schwamm. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2013, 464 Seiten, 24,95 €