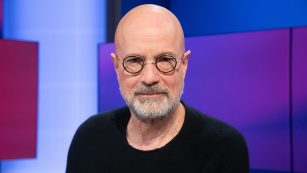Es war der Film, der in Cannes mit am meisten für Gesprächsstoff sorgte: die radikale Dramatisierung des Holocaust durch Jonathan Glazer, der in »The Zone of Interest« das gleichnamige Buch des am 19. Mai verstorbenen Schriftstellers Martin Amis für ein raffiniertes Spiel über die Bande nutzt und in seiner schockierenden (Nach-)Wirkung durchaus an »Shoah« von Claude Lanzmann heranreicht.
Die große Wucht von Glazers Film hat viel mit der konzeptionellen Strenge der Inszenierung zu tun, die durchgängig aus der Halbdistanz auf die Familie des KZ-Kommandanten von Auschwitz, Rudolf Höß, und seiner Frau Hedwig blickt, die in einer Villa außerhalb des Vernichtungslagers mit ihren fünf Kindern und mehreren Bediensteten leben.
Wenn man die lange, von einem abgründigen Wummern bestimmte Titelsequenz einmal weglässt, die den Film in der Jetztzeit verankert und das Grauen des Folgenden intoniert, hebt der Film mit einer bestechenden Idylle an. Inmitten einer friedlich-grünen Natur hat sich eine Familie an einem Flussufer niedergelassen. Die Blätter rauschen im Wind, Kinder vergnügen sich im Wasser, abends kehren die Ausflügler in zwei schwarzen Limousinen in ihr herrschaftliches Haus zurück.
Erst am nächsten Morgen realisiert man, dass das Anwesen unmittelbar an der Mauer des KZs liegt, aus dem immer wieder Schreie, Schüsse und ein düsteres Grollen herüberdringen. Doch bis auf die Silhouette eines Wachturms und dem Rauch und Feuer spuckenden Schlot des Krematoriums bleiben die Todesmühlen von Auschwitz-Birkenau strikt außerhalb des Bildes.
»Ein Paradies«, schwärmt Hedwig, als sie ihre Mutter durch den Garten führt, hinter dessen betongrauer Wand im selben Augenblick hunderte Menschen geschoren, entkleidet, vergast, ihrer Goldzähne beraubt und verbrannt werden.
Aus dieser Diskrepanz zwischen bieder-herrischer Bürgerlichkeit und dem Wissen um den industriell organisierten Massenmord erwächst eine atemlose Spannung, die keine Auflösung zulässt, sondern bis zum Schluss an den unerträglichen Widersprüchen festhält.
Während Hedwig zum Kaffeekränzchen lädt, empfängt der Kommandant zwei Manager von Topf & Söhne, die ihm die neuen Krematorien in Auschwitz II erläutern, welche im Dauerbetrieb beladen und betrieben werden können. Abends legt er sich dann zu seinen Töchtern ins Bett und liest ihnen mit weicher Stimme Märchen vor.
Mehrmals schaut die Kamera dem von Christian Friedel gespielten Höß schlicht dabei zu, wie er abends durch das Haus geht, eine Lampe nach der anderen löscht, die Türen schließt und sich dann schlafen legt. Es gibt keine Psychologie, keine Angst, keine Albträume; nur zwei mit der Wärmekamera fotografierte Sequenzen, in denen ein namenloses Mädchen nachts Obst und Kartoffel für die Gefangenen am Wegrand versteckt.
Die konzentrierte Stille und der streng registrierende Gestus der Aufnahmen, die nichts erklären oder forcieren wollen, bedingen eine enorme Konzentration, die auch bei eher handlungsorientierten Passagen nicht schwindet, etwa wenn Höß bei einem Bootsausflug mit seinen Kindern in KZ-Abwässer mit menschlichen Überresten gerät oder er im Sommer 1943 nach Berlin versetzt wird, was zu einer handfesten Ehekrise führt, weil seine Frau (biestig-deutsch: Sandra Hüller) das Anwesen in Auschwitz auf keinen Fall verlassen will.
Auch für die Anbindung des Films an die Gegenwart findet Glazer einen visuell und dramaturgisch bezwingenden Dreh, wenn er Höß in einem Moment höchster Macht für einen Augenblick schwächeln lässt und das zu einem Zeitsprung in die heutige Ausstellung auf dem Gelände des KZ in Auschwitz nutzt, das vom Museumspersonal gerade für den nächsten Besucheransturm hergerichtet wird.