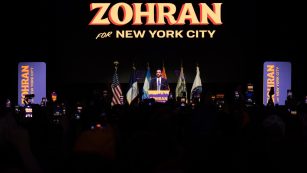Pünktlich um 9.45 Uhr läutet die Schulglocke der jüdischen Schule in Tallinn die erste große Pause ein. Die Schüler stürzen aus ihren Klassen, und Oberrabbiner Shmuel Kot versammelt sich mit etlichen Betern in der neuen Synagoge nebenan zum Schacharit, dem Morgengebet. Zehn Jahre ist es her, dass der 33-jährige Chabad-Rabbiner aus Israel nach Estland kam. Er empfinde sich als Missionar, sagt er. Er sei stolz, der erste Rabbiner Estlands nach der Schoa zu sein.
Als er 2000 in die estnische Hauptstadt kam, gab es dort nichts: weder eine Synagoge noch ein morgendliches Gebet. Er habe bei Null beginnen müssen, erinnert sich Kot. Sogar noch heute, 20 Jahre nach dem Ende des Sozialismus, hätten viele Angst, laut zu sagen, dass sie Juden sind. »Sie haben ihr Judentum nie praktiziert«, sagt Kot. Deshalb habe die Gemeinde direkt nach der Unabhängigkeit Anfang der 90er-Jahre erst einmal notwendige Strukturen geschaffen und einen Gebäudekomplex gebaut: Neben der Schule mit ihren 265 Schülern erhebt sich das vierstöckige Gemeindezentrum, in dem kürzlich auch das Jüdische Museum Estlands eröffnet wurde.
Frühstück Der Stolz vieler Juden des Landes aber ist die verglaste Synagoge gegenüber, die nach ihrer Eröffnung vor vier Jahren gleich mehrmals für ihre außergewöhnliche Architektur ausgezeichnet wurde. Jetzt sei es an der Zeit, die jüdische Gemeinde mit Leben zu füllen, sagt Oberrabbiner Kot. »Deshalb starte ich zum Beispiel montags und dienstags sehr behutsam mit einem gemeinsamen Frühstück für Rentner und schließe Gebete oder Toralektionen an, die für alle Besucher offen sind.«
Anders als bei den baltischen Nachbarn Lettland und Litauen hat sich jüdisches Leben in Estland erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt. Die Gemeinde wurde 1830 gegründet, erzählt Juzef Luvishtuk, der ehrenamtliche Leiter des Jüdischen Museums. Wenig später wurden in Tallinn, dem früheren Reval, und in Tartu, dem damaligen Dorpat, Synagogen gebaut, es folgten Grund- und Talmudschulen. Allerdings war die jüdische Gemeinde im Land mit nur 4.500 Mitgliedern vor dem Zweiten Weltkrieg ziemlich klein.
Vielleicht hätten sie gerade deshalb nie unter einem staatlichen Antisemitismus gelitten, vermutet Luvishtuk. Übergriffe habe es in Estland erst von den Kommunisten gegeben. Denn als Folge des Hitler-Stalin-Pakts besetzte die Rote Armee 1940 erstmals das Land. Ein Jahr später, am 14. Juni 1941, wurden mehr als 450 wohlhabende estnische Juden enteignet und gemeinsam mit knapp 10.000 nichtjüdischen Esten nach Sibirien verbannt.
Kulturhauptstadt Luvishtuk ist froh, dass die estnische Regierung daran in diesem Kulturhauptstadtjahr mit einem Gedenkstein erinnern will. Jeder im Land wisse, dass damals tausende Esten deportiert worden seien, sagt er. Dass darunter aber auch zehn Prozent der jüdischen Minderheit waren, sei bis heute nur wenig bekannt. Kaum waren sie von den Kommunisten nach Sibirien gebracht, nahm im Juli 1941 die deutsche Wehrmacht Estland ein. Juzef Luvishtuks Eltern wurden, wie die meisten estnischen Juden, kurz vor dem Einmarsch der Nazis von den russischen Besatzern in den Osten evakuiert und überlebten den Holocaust im asiatischen Teil der ehemaligen Sowjetunion, in Tadschikistan.
Bis Ende 1941 ermordeten die Deutschen rund 1.000 estnische Juden. Wie in Litauen und Lettland hatten die Nazis Arbeits- und Konzentrationslager errichtet, die vor allem für ausländische Juden vorgesehen waren. In Viehwaggons wurden sie aus Westeuropa in die größten KZ Vaivara und Klooga verschleppt, wo mehr als 10.000 Menschen ermordet wurden oder an Krankheit und Erschöpfung starben.
Juzef Luvishtuk war gerade zwei Jahre alt, als er nach dem Krieg 1945 mit den Eltern zurück nach Estland kam. Es war zwar Sowjetrepublik, aber wie vor dem Krieg sei man Juden gegenüber sehr tolerant gewesen, erinnert er sich. »Der Staatsantisemitismus war schrecklich in der Sowjetunion«, sagt er. »Im Jahre 1953, als Stalin begann, alle Juden in der ehemaligen UdSSR zu verfolgen, suchten viele in Estland Schutz. Berühmte Leute und Fachkräfte kamen zu uns, weil man hier immer freundlich gegenüber Juden war.« Viele seien später weitergezogen nach Israel, sagt Luvishtuk. Von Russland aus hätten sie kaum auswandern können.
Russischsprachig Heute zählt die jüdische Gemeinde in Estland rund 2.800 Mitglieder. Streng genommen seien es erheblich weniger, denn nicht jeder zahle seinen Mitgliedsbeitrag, sagt ihr Leiter Vadim Ryvlin. Aber unter allen Juden im Land seien nur knapp 350 estnische Juden. Mehr als 2.500 kämen aus anderen Republiken der ehemaligen Sowjetunion und sprächen Russisch – wie Ryvlin selbst. »Mein Vater kam nach dem Krieg als Offizier der Roten Armee an die Ostsee«, sagt der Gemeindechef, der 1975 in Tallinn geboren wurde.
Während es in anderen Kreisen im Land immer wieder Konflikte mit dem russischsprachigen Teil der Bevölkerung gebe, der während des Freiheitskampfes auch als »Okkupanten« beschimpft wurde, sei man in der jüdischen Gemeinschaft sehr tolerant, freut sich Ryvlin. Estnische und russische Juden kämen gut miteinander aus. Froh sei er auch über den guten Ruf, den die jüdische Schule habe. An der öffentlichen Einrichtung seien auch Nichtjuden willkommen, die Warteliste sei lang. Froh ist Ryvlin vor allem über die Offenheit der jüdischen Einrichtungen untereinander. Konkurrenz kenne man nicht, sagt er.
Vielleicht liegt es daran, dass Ryvlin und Oberrabbiner Shmuel Kot nicht nur nahezu gleichaltrig sind, sondern beide, nach eigenem Beteuern, nur ein einziges Ziel kennen: die junge Generation zurückzubringen in die jüdische Gemeinde. Er selbst besuche die Synagoge allerdings nur zweimal im Jahr, sagt Ryvlin. »Vielleicht ist es ein Teil meines sowjetischen Erbes.« Erst gestern habe ihn seine 13-jährige Tochter gefragt, warum das so ist. »Für sie spielt die jüdische Religion eine immense Rolle, sie wartet schon jetzt auf das große Jugendcamp im März.«