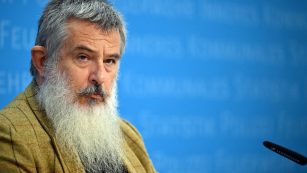von Wolf Scheller
und Michael Wuliger
In der französischen linken und liberalen Geschichtsschreibung gilt die Dreyfus-Affäre als Geburtsstunde der modernen Intellektuellen. Von Emile Zola, dessen Manifest J’accuse 1898 die Affäre ins Rollen brachte, über Jean-Paul Sartre in der Nachkriegzeit bis zu Bernard-Henri Levy wird heute die Traditionslinie der politisch engagierten Schriftsteller und Denker gezogen. Vernachlässigt – oder verdrängt? – wird dabei oft, daß mit der Dreyfus-Affäre auch ein anderes nationales Phänomen seinen Anfang nahm: der moderne französische Rechtsradikalismus, der aktuell in Gestalt von Jean-Marie Le Pen und Philippe de Villiers in der französischen Politik ein Faktor von beträchtlichem Gewicht ist.
Die Dreyfus-Affäre beginnt im Dezember 1894, als der aus dem Elsaß stammende Armeehauptmann Alfred Dreyfus we-gen angeblicher Spionage für Deutsch- land aus der Armee ausgestoßen, degradiert und zu lebenslanger Verbannung auf der Teufelsinsel verurteilt wird. Dreyfus ist Jude. Die rechte Zeitung La Libre Parole kommentiert: »Hier wurde nicht ein Einzelner für ein individuelles Verbrechen degradiert. Die Schande einer ganzen Rasse wurde in aller Nacktheit bloßgestellt.« Als die Familie des Verurteilten, unterstützt von der französischen Linken, eine Kampagne einleitet, um den Fall neu aufzurollen, spricht die rechte Presse von einem »jüdischen Syndikat«, einer Verschwörung gegen Staat, Militär und Gesellschaft.
Es geht in dem zunehmend erbittert geführten Streit nur vordergründig um das individuelle Schicksal von Alfred Dreyfus. Hier stehen sich zwei politische Lager gegenüber, deren Todfeindschaft seit dem Sturm auf die Bastille 1789 Frankreich spaltet. Auf der einen Seite Royalisten und katholische Kirche, für die Demokratie, Aufklärung und Menschenrechte Verstöße gegen die gottgewollte Ordnung sind, angezettelt von Freimaurern und Juden. »Dreyfus ist ein Agent des internationalen Judentums, das den Ruin des französischen Volkes beschlossen hat«, schreibt das Organ der Kirche, La Croix. Den Gegenpol markiert die republikanische Linke. Sie macht sich die Sache Dreyfus’ zu eigen – nicht unbedingt aus Sympathie für den Verurteilten oder gar aus Liebe zu den Juden, sondern vor allem aus ihrer Gegnerschaft zu Klerikalen und Reaktionären. »Die Leute …, die ich anklage … sind für mich nur Verkörperungen des Geistes der sozialen Bosheit. Und die Tat, die ich hier begehe, ist nur ein revolutionäres Mittel, um die Explosion der Wahrheit und der Gerechtigkeit zu beschleunigen« formuliert Zola in seinem berühmt gewordenen Artikel J’accuse, der 1898 in der Zeitschrift L’Aurore des linken Abgeordneten und späteren Ministerpräsidenten Georges Clemenceau.
Zola enthüllt, daß Dreyfus unschuldig ist. Der Leiter der Spionageabwehr des Generalstabs, Oberst Picquard, hat herausbekommen, daß nicht Dreyfus der Spion war, sondern der katholische Major Esterhazy. Doch Esterhazy wird von einem Kriegsgericht freigesprochen, Picquard nach Algerien versetzt. Ein Dreivierteljahr darauf meldet die Presse, daß Picquards Nachfolger als Chef des Nachrichtendienstes, Oberstleutnant Henry, wegen Fälschung von Beweisen im Zusammenhang mit der Affäre Dreyfus verhaftet worden ist und er in seiner Zelle auf dem Mont-Valérien mit einem Rasiermesser Selbstmord verübt hat. Der Kampf um Dreyfus’ Freilassung gewinnt an Boden. Am 12.Juli 1906 schließlich annulliert der Kassationsgerichtshof das Urteil gegen den jüdischen Hauptmann. Er wird rehabilitiert und erhält am 21.Juli die Insignien eines Ritters der Ehrenlegion in eben dem Hof der Militärschule, wo er im Januar 1895 die beschämende Prozedur seiner Degradierung über sich ergehen lassen mußte. General Picquard wird wenige Monate später von Georges Clemenceau zum Kriegsminister berufen. Dreyfus und die »Dreyfusards« , wie Zola und seine Freunde genannt werden, haben scheinbar gesiegt.
Für die unterlegene Seite aber geht der Kampf weiter. Das Ende der Affäre ist für sie »Der Triumph der Juden«, wie La Libre Parole am 13. Juli quer über die erste Seite titelt. Die Rechte schwört Rache. Ihr publizistischer und ideologischer Wortführer wird ein bis dahin noch wenig bekannter Journalist namens Charles Maurras. Maurras hatte sich erstmals 1898 nach dem Tod von Oberstleutnant Henry zu Wort gemeldet. In einem Zeitungsartikel, überschrieben »Das erste Blut«, machte er aus dem Fälscher und Selbstmörder Henry einen »Helden der Nation« und bedient sich dabei des Mythos des Blutes, das, von jüdischer Feindeshand vergossen, nach Rache schreit. »Dieses Blut raucht, und es wird schreien, bis es gesühnt ist«, droht Maurras den »Mitgliedern des Verrätersyndikats.«
Aus dem blutrünstigen jungen Journalisten wird der Vordenker nicht nur der französischen modernen Rechten, sondern des europäischen Faschismus. Maurras Organisation Action Francaise bekämpft mit einem Programm des Anti- modernismus, Antikapitalismus, Antiliberalismus und Antisemitismus die Republik – Elemente, wie sie später Mussolini und Hitler auch in ihren Bewegungen aufgreifen werden.
Die Stunde der »Antidreyfusards« und ihrer Erben schlägt 1941, als Frankreich vor dem nationalsozialistischen Deutschland kapituliert. In Vichy errichtet die französische Rechte den »Etat francais« nach den Vorstellungen von Maurras: autoritär, katholisch – und judenrein. Polizei und Milizionäre verhaften Juden, die staatlichen Eisenbahnen deportieren sie gen Osten. 80.000 französische Juden fallen der Schoa zum Opfer. Als Charles Maurras 1944 nach der Befreiung verhaftet und zu lebenslanger Haft verurteilt wird, ruft er aus: »C’est la revanche de Dreyfus!« Maurras stirbt 1952 im Zuchthaus. Sein Erbe lebt fort. Meinungsumfragen zufolge ordnet sich aktuell ein Drittel der Franzosen in das Lager der extremen Rechten ein – so viele wie nie zuvor.