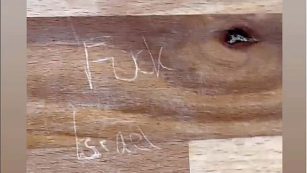Sie sah die jungen Soldaten auf der Straße – und sofort sehnte sie sich nach dem, was diese für sie ausstrahlten: »Stärke und Sicherheit«. So begründet Odeleya aus Deutschland, warum sie sich dazu entschloss, einen mehrjährigen Militärdienst in Israel abzuleisten.
Odeleya ist kein Einzelfall. In jedem Jahr melden sich etliche Freiwillige, junge jüdische Frauen und Männer aus der ganzen Welt, die bei den israelischen Streitkräften dienen wollen. Sie sind bereit, dafür eine Menge aufzugeben: persönliche Sicherheit, familiäre Nähe und Geborgenheit, die Freiheit eines selbstbestimmten, privaten und von individuellen Mustern geprägten Lebens. Was treibt diese jungen Menschen dazu?
Die Antworten darauf mögen vielfältig sein. Aber es gibt gleichzeitig verblüffende Übereinstimmungen. »Ich sah bei ihnen allen die glänzenden Augen und den Stolz«, beschreibt der Fotograf Rafael Herlich seine Beobachtungen. Seit mehreren Jahrzehnten fängt er mit seiner Kamera die vielfältigsten Momente und Motive des modernen jüdischen Lebens ein.
Doch dieses Mal war alles anders, denn es ging um Herlichs eigene Tochter Orly. Die heute 21-Jährige war nach dem Abi als Neueinwanderin nach Israel gegangen und hatte ihn und seine Frau Huberta kurz darauf mit ihrer Entscheidung konfrontiert, den für alle jungen Israelis obligatorischen Militärdienst ableisten zu wollen, weil sie »nicht nur nehmen, sondern dem Land auch etwas geben« wolle.
Mission Dieser Satz kehrt häufig wieder, wenn man die »Chayalim bodedim« (die Soldaten ohne familiären Rückhalt im Land) nach ihren Motiven befragt. »Ich habe Alija gemacht, war begierig darauf, die Kultur, die Sprache und das Land kennenzulernen, und bin nach meiner Ankunft sofort in einem Kibbuz untergekommen. Für diese freundliche Aufnahme wollte ich Israel danken. Etwas für dieses Land zu tun, sehe ich als meine Mission an«, beschreibt Orly Herlich mit eigenen Worten, was sie zu ihrem Eintritt ins Militär bewog.
Aber sie hat noch mehr getan: Gemeinsam mit ihrem Vater hat sie ein Buch herausgegeben, in dem zahlreiche andere »lone soldiers« wie sie porträtiert werden. Ihr Vater hat diese meist jungen, strahlenden Gesichter fotografiert. Orly erzählt in einfühlsamen Texten die jeweilige Geschichte dazu – authentische Dokumente einer »Suche nach Wurzeln«, wie es im Untertitel des Bildbandes heißt.
Im Festsaal des Frankfurter Gemeindezentrums haben Vater und Tochter Anfang Dezember ihre Fotodokumentation vorgestellt. In sehr persönlich gehaltenen Worten erzählt Herlich, welche Empfindungen ihn bei der Arbeit an dem Buch begleitet haben: »Ich sah die Soldaten, die die Klagemauer in Jerusalem bewachen. Und plötzlich musste ich an meinen Halbbruder denken, der als Kleinkind im Konzentrationslager ermordet wurde. Mir schoss es durch den Kopf: Diese Soldaten sind hier, damit sich das, was meinem Bruder angetan wurde, niemals wiederholen wird. Für mich sind sie alle stille Helden.«
Und hatten er und seine Frau während der ganzen Zeit keine Angst um ihre Tochter? Huberta Herlich schüttelt den Kopf: »Nein«, sagt sie. »Ich empfand Gottvertrauen, und das gab mir die Sicherheit, dass Orly nichts passieren würde.«
verbündete Doch nicht nur Rafael und Orly Herlich, die beiden Herausgeber des Bildbands Chayalim bodedim. Meine Reise ins israelische Militär, kamen an diesem Abend zu Wort. Hellmut Königshaus, ehemaliger Wehrbeauftragter und amtierender Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, hob in seiner Rede die Bedeutung Deutschlands für Israel hervor: »Nach den USA sind wir für Israel die wichtigsten Verbündeten«, sagte er.
Und Frankfurts Bürgermeister Uwe Becker erinnerte daran, dass der »Verteidigungsfall« für die israelischen Streitkräfte kein abstraktes Strategie- oder Gedankenspiel ist, sondern Realität und Alltag. Seines Erachtens erklärt das auch, warum kaum eine andere Armee der Welt so fest in der Mitte der Gesellschaft verankert ist wie die israelische. Becker drückte außerdem ebenfalls seine Bewunderung für den Mut der jungen jüdischen Männer und Frauen aus, die bereit seien, so viel persönlich zu riskieren, um diesem Land zu dienen.
Anschließend lud Doron Kiesel, Wissenschaftlicher Direktor der Bildungsabteilung im Zentralrat, der mit großem Einfühlungsvermögen durch diesen Abend führte, vier Gesprächsgäste auf das Podium. Sie alle – wie übrigens auch Kiesel selbst, der erzählte, wie er am Tag nach seinem Abitur das Schiff nach Haifa bestieg, um sich dort zum Militärdienst zu melden – konnten über eigene oder familiäre Erfahrungen in der israelischen Armee berichten.
So schilderte etwa Yoni Rose, seit knapp zwei Jahren Chasan in der Frankfurter Gemeinde, wie er als ein aus den USA stammender Freiwilliger an einem Freitagabend in Israel mit den Kameraden vor einem Zelt saß und irgendwann begann, Schabbatlieder zu singen, einfach so und nur für sich selbst. Plötzlich trat der Kommandeur vor ihn hin und zeigte ihm die Scharen von Soldaten, die sich genähert hatten, um seinem Gesang zu lauschen. »Ich erhielt den Befehl, künftig an jedem Schabbat und Feiertag zu singen«, erzählte Rose.
Heimat Vielen jungen Menschen hilft die Zeit beim Militär, erwachsen zu werden und »herauszufinden, was wichtig ist und was nicht«, wie Gerry seine Erfahrung als »lone soldier« rückblickend zusammenfasste. Oft hat man auch den Eindruck, dass junge Juden in der Diaspora auf diesem Wege zu klären versuchen, wohin sie gehören, und die Koordinaten, was für sie Heimat bedeutet, nach dem Aufenthalt in Israel neu justieren.
Im Publikum ist auch Noam, gerade 18 Jahre alt geworden. Seine Pläne für die Zeit nach der Schule stehen bereits fest: Auch er wird Alija machen und sich anschließend zum Militärdienst melden. Und schon jetzt strahlt er jene Entschlossenheit und Gewissheit aus, die Rafael und Orly Herlich bei so vielen »Chayalim bodedim« beobachten konnten. Und wenn er doch in Deutschland bliebe, würde er dann auch zur Bundeswehr gehen? »Nein, niemals«, sagt Noam.