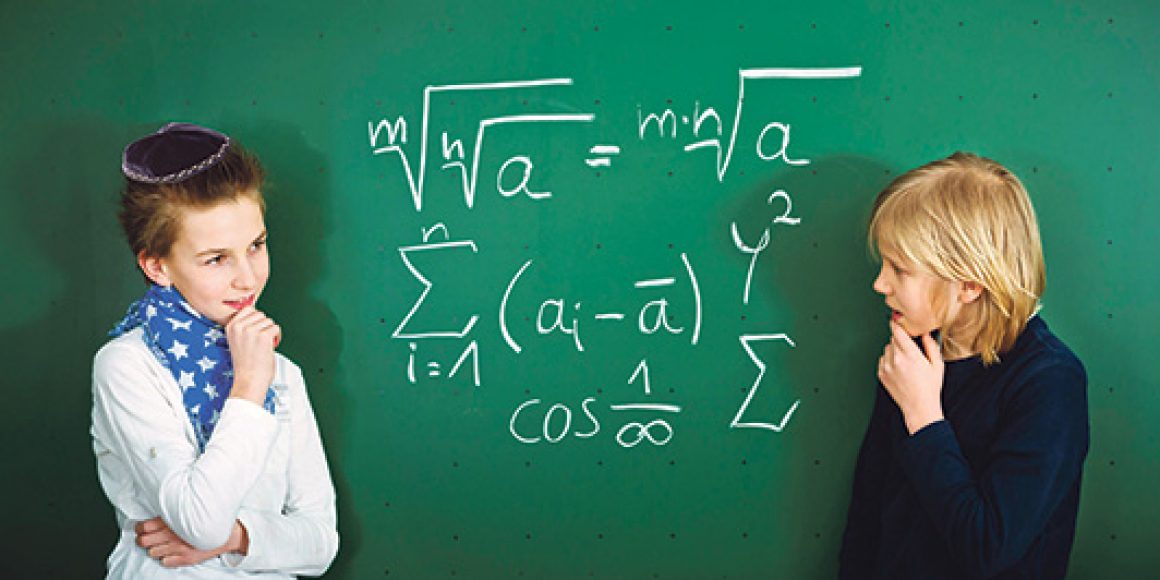Pro
Sollen wir unser Kind in die jüdische Grundschule schicken? In Frankfurt am Main haben Eltern mindestens vier triftige Gründe für ein klares Ja: 1. Viele Gemeindemitglieder treffen diese Entscheidung. 2. Eine jüdische Erziehung ist uns wichtig. 3. Die öffentliche Grundschule gefällt uns nicht, die Lichtigfeld-Schule hingegen hat einen guten Ruf. 4. Wir brauchen einen garantierten Hortplatz mit zuverlässiger Betreuung.
Es gibt aber auch noch ein weiteres praktisches Argument: Da viele Gemeindemitglieder ihre Kinder in die jüdische Grundschule schicken, erlebt jeder, der sein Kind im jüdischen Kindergarten unterbringt, jährlich den »Massen-Exodus« der Fünfjährigen.
Denn schon in diesem Alter werden Lichtigfeld-Schüler eingeschult – mit Zuckertüte und großer Feier geht es in die Eingangsstufe, sozusagen in Klasse 0. Wer sein Kind dagegen im Anschluss an den jüdischen Kindergarten in die öffentliche Grundschule schickt, entscheidet damit automatisch, dass Junior ein ganzes Jahr lang ausschließlich mit deutlich jüngeren Kindern verbringen muss.
Doch das sicherlich gewichtigste Argument für eine jüdische Schule ist die jüdische Erziehung: Traditionen und Riten werden vermittelt, die Kinder lernen jüdische Denk- und Sichtweisen kennen. Gerade für Familien, die zu Hause säkular leben und selbst nicht viel über ihre Religion wissen, ist eine jüdische Schule ideal.
Dasselbe gilt für Kinder, die einen nichtjüdischen Elternteil haben – und deren jüdischem Elternteil es wichtig ist, dass ihre Kinder im Judentum verwurzelt werden. Denn die Schüler werden in jüdischer Religion unterrichtet und lernen Iwrit, sie feiern die Feiertage vorab in der Schule und begreifen, dass diese etwas Besonderes sind – nicht zuletzt, weil sie deshalb schulfrei bekommen. An einer öffentlichen Schule dagegen können auch Drei-Tage-Juden in die Bredouille kommen – etwa, wenn die Klassenfahrt auf Jom Kippur fällt.
Das Thema Klassenfahrten ist besonders für religiöse Familien ein Argument, sich für eine jüdische Schule zu entscheiden. Schließlich können sie nur so sichergehen, dass die Kaschrut – ebenso wie in der Schule – eingehalten werden. Denn selbst bei den Süßigkeiten, die Kinder von zu Hause mitbringen dürfen, sind Eltern aufgefordert, sich an die Koscherliste zu halten.
Eine jüdische Identität für die Kinder zu schaffen, ist aber nur eines der Verdienste einer jüdischen Grundschule. Ein weiteres Verdienst ist es, dass sie auch den Eltern eine (Wieder-)Annäherung an die Religion ermöglicht. Sozusagen im Windschatten des Kindes können sie ertasten und erproben, wie viel Religion das eigene Ich zulassen möchte. Und nichtjüdische Ehepartner bekommen bei Schulfesten einen sanften Kontakt mit jüdischen Festen. Ein komprimierter Schulseder vermittelt auch einen Eindruck von Pessach und ist vielleicht weniger »abschreckend« als ein langer, traditionell gefeierter Sederabend.
Langfristig bindet eine jüdische Schule die Kinder auch in die jüdische Gemeinschaft ein. Es fällt ihnen leichter, an den Aktivitäten des Jugendzentrums und an den Machanot teilzunehmen – schließlich treffen sie dann auch ihre Mitschüler und nicht nur lauter fremde Gesichter. Und noch langfristiger betrachtet, vielleicht sogar einen jüdischen Ehepartner ...
Die jüdische Schule in Frankfurt ist eine Privatschule. Die Kinder können dort unabhängig vom Wohnort angemeldet werden. Ein klarer Vorteil im Gegensatz zur öffentlichen Grundschule, die man nur per Gestattungsantrag umgehen kann, wenn ihre Nachteile zu groß scheinen. Manche jüdische Eltern, die in einem Stadtteil mit hohem Anteil an Migranten mit muslimischem Hintergrund wohnen, bevorzugen die Lichtigfeld-Schule aus diesem Grund.
Denn in einer jüdischen Schule laufen die Kinder nicht Gefahr, mit antisemitischen Sprüchen oder Vorurteilen konfrontiert zu werden. Gerade die Generation der »Helikopter-Eltern«, die gerne über ihre Kinder wacht, fühlt sich an der jüdischen Schule wohl: Sie ist klein und gemütlich, die Lehrer sind zugewandt und warmherzig, kurzum: Es ist ein wenig wie ein Zuhause.
Und last but not least: Die jüdische Grundschule in Frankfurt liefert einen Hortplatz frei Haus. Wer möchte, kann sein Kind um 7.30 Uhr abgeben und um 17 Uhr abholen – ohne dass die Kinder von der Schule zu einem Hort laufen müssen, denn dieser befindet sich sowohl in der Eingangsstufe als auch in der Grundschule im Gebäude der Schule. Sicherheit, jüdisches Leben, Wärme und gute Lehrer: aus meiner Sicht ein eindeutiges Pro für die jüdische Grundschule – übrigens nicht nur für jüdische Eltern!
Rivka Kibel ist Reisejournalistin und Korrespondentin der Jüdischen Allgemeinen in Frankfurt am Main. Ihre beiden Kinder haben die jüdische Lichtigfeld-Grundschule besucht.
Contra
Jüdische Werte und Inhalte als Teil des Schulalltags, ein Grundstein für lebenslange Freundschaften innerhalb der jüdischen Gemeinde, Hebräischkenntnisse – für den Besuch einer jüdischen Grundschule spricht vieles. Trotzdem haben wir uns entschieden, unsere ältere Tochter auf eine staatliche Schule zu schicken. Ein Grund dafür war so pragmatisch wie wichtig: die Entfernung. Als ich zur Schule ging, gab es keine jüdische Grundschule in Berlin.
Heute gibt es drei – eine beeindruckende Entwicklung. Aber Berlin ist groß (892 Quadratkilometer), und wenn man nicht zufälligerweise in der Nähe einer dieser Grundschulen wohnt, bedeutet die Entscheidung für eine jüdische Grundschule zunächst einmal einen langen, vielleicht sogar sehr langen und aufwendigen Schulweg. Selbst wenn sich dieser Weg (und der Weg zu den dann über Berlin verstreuten Schulfreunden) in den Alltag integrieren lässt, kostet er zwangsläufig wertvolle Zeit.
Statt abends gemütlich mit meiner Tochter zu spielen, müsste ich sie schnell ins Bett bringen, damit sie morgens rechtzeitig für den langen Schulweg wach wird. So kann eine Entscheidung für eine jüdische Grundschule auch eine Entscheidung für weniger gemeinsame Familienzeit sein.
Berlin ist nicht nur groß. Es hat neben den drei jüdischen noch 430 weitere Grundschulen – sprich, eine Riesenvielfalt. Den Unterricht in unserer Einzugsschule (rund 100 Meter entfernt) haben wir über offene Schultage kennengelernt. Wir waren schlicht begeistert: vom pädagogischen Konzept, vom respektvollen Umgang mit den Kindern, von den kreativ gestalteten Räumen und von vielem mehr.
Natürlich hätte es anders kommen können, und natürlich können auch jüdische Grundschulen mit fantastischen Konzepten, Menschen und Lernumgebungen glänzen. Aber solange jüdische Grundschulen nur einen verschwindend kleinen Teil aller Schulen ausmachen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass eine der vielen anderen Schulen zum Beispiel ein besseres pädagogisches Konzept hat, die Entwicklung von Sozialkompetenzen besser fördert, die Lernbegeisterung besser weckt – oder ganz einfach nur besser zu den individuellen Bedürfnissen eines Kindes passt.
Wir haben das Glück, dass auf dem Lehrplan unserer nichtjüdischen Schule auch jüdische Inhalte stehen. Es ist selbstverständlich, dass die Kinder jüdische Lieder kennenlernen und etwas über jüdische Feste erfahren. Die Kinder im Schülerladen, einer Art Hort, haben die Geschichte der Juden, die früher in dem Haus gewohnt haben, recherchiert und geholfen, Geld für die Verlegung von Stolpersteinen zu sammeln.
Es freut uns, dass wir mit unserer Entscheidung für die Grundschule einen Beitrag für eine plurale und tolerante Gesellschaft leisten – eine Gesellschaft, die nur bestehen kann, wenn es Orte gibt, an denen sich Menschen unterschiedlicher Herkunft kennen und schätzen lernen können.
Dennoch: Wir wissen auch, dass längst nicht alle Schulen jüdischen Kindern eine sichere Umgebung bieten; dass unsere Kinder angegriffen und ausgegrenzt werden können. Davor müssen wir sie schützen. In manchen Fällen mag die Wahl einer jüdischen Grundschule sogar der einzige Weg sein. Es kommt immer auf den Einzelfall an, aber ich bin überzeugt, dass es in Deutschland sehr viele Grundschulen gibt, in denen unsere Kinder sicher aufwachsen und ihre Erfahrungen einbringen können.
Manche Eltern wollen ihre Kinder auch davor schützen, sich in einem von christlicher Tradition geprägten Schulalltag (in dem Feste wie Ostern und Weihnachten eine wichtige Rolle spielen) als Außenseiter fühlen zu müssen. Dieses Gefühl muss dabei keinesfalls zwangsläufig entstehen. Die Einbindung in die jüdische Gemeinde (über Machanot, Maccabi, Bambinim, jüdische Kindergärten et cetera), gelebte Traditionen, Reisen nach Israel – all das kann Kindern helfen, ihr Judentum als etwas zugleich Besonderes und Selbstverständliches zu erleben.
Dann können die Erfahrungen in der Schule auch eine Quelle des Stolzes sein – des Gefühls, in einer anderen, besonderen Tradition zu stehen. Und es kann das Selbstbewusstsein und die persönliche Widerstandskraft stärken, mit mehreren Wertetraditionen vertraut zu sein, Freunde aus unterschiedlichen Kontexten zu haben und sich selbstverständlich sowohl als Teil der deutschen Gesellschaft als auch als Jude zu verstehen.
Daniel Friedrich ist Philosoph und arbeitet derzeit als Lehrer an einer Schule in Berlin-Moabit. Seine sechsjährige Tochter besucht eine staatliche Grundschule in Berlin-Schöneberg.